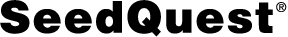|
Jennifer Doudna: „Alle werden von CRISPR profitieren“ - In Wien sprach Nobelpreisträgerin Jennifer Doudna an der ÖAW über die Chancen und Risiken der Genschere CRISPR – und darüber, wie das Werkzeug unsere Gesundheit, Ernährung und sogar den Klimaschutz revolutionieren könnte Vienna, Austria Dass Jennifer Doudna fünf Jahre nach ihrer Nobelpreisverleihung ausgerechnet in Wien über das Verändern von Genen spricht, passt. Denn ein großer Teil der bahnbrechenden Arbeit, den die US-Amerikanerin und ihre französische Kollegin Emmanuelle Charpentier damals rund um die sogenannte CRISPR-Technologie leisteten, hat in der österreichischen Hauptstadt stattgefunden – Charpentier war zu der Zeit unter anderem für die Universität Wien tätig. Damals hatte noch niemand geahnt, wie groß die Auswirkungen der neuen Gentechnologie sein würden, verriet Doudna bei einem „Science Update“ vor Journalistinnen und Journalisten anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des GMI – Gregor-Mendel-Instituts für Molekulare Pflanzenbiologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Heute sei klar: „Die Technologie ist mächtig. Und muss verantwortungsvoll genutzt werden.“ Doudna und Charpentier entdeckten damals – ausgehend von Bakterien und wie sie Virusinfektionen bekämpfen – die Funktion der programmierbaren CRISPR-Cas-Proteine. CRISPR steht für „Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats“, das sind kurze, sich wiederholende DNA-Abschnitte, die in Bakterien als Teil eines natürlichen Abwehrmechanismus gegen Viren dienen. In Kombination mit dem Enzym Cas9 entstand daraus ein molekularbiologisches Werkzeug – heute unverzichtbar für die Human-, Tier- und Agrarforschung. Denn mit der CRISPR-Technologie ist es möglich, spezifische DNA-Sequenzen zu erkennen, zu schneiden und zu verändern. Das Erbgut von Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und Menschen konnte plötzlich günstiger, schneller und präziser verändert werden als bisher. Binnen kürzester Zeit revolutionierte die CRISPR-Technologie die Welt der Wissenschaft, Doudna und Charpentier wurden 2020 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Vom dürreresistenten Reis bis zur Krebstherapie Doch gerade in Österreich sei die Frage der Gentechnik eine „heiß umkämpfte“, gab ÖAW-Präsident Heinz Faßmann bei Doudnas Begrüßung zu Bedenken. Er verstehe nicht ganz warum denn eigentlich gelte es vielmehr, das Potenzial der neuen Technologie mehr auszuschöpfen. Liam Dolan, stellvertretender Direktor des GMI betonte, wie grundlegend Gentechnik im Zusammenhang mit Pflanzenforschung für die Zukunft der Menschheit sei. „Es sind Pflanzen, die uns Energie liefern – Energie, die wir brauchen.“ Jennifer Doudna habe schon früh gewusst, welche Chancen in der Pflanzengentechnik liegen. „Wir alle müssen atmen und essen und Pflanzen sind die Basis des Lebens auf diesem Planeten, also ist es wichtig, zu verstehen, was da vor sich geht“, sagte die Molekularbiologin, die auch gern in ihrer Freizeit beim Garteln in die Welt der Pflanzen abtaucht. Mithilfe der CRISPR-Technologie lassen sich dürreresistente Reissorten oder Tomaten mit höherem Nährwert produzieren. „Alle auf diesem Planeten werden von dieser Technologie profitieren“, ist Doudna überzeugt. Nicht nur im Anwendungsbereich Pflanzen: „Es ist unglaublich interessant, was alles passiert“, schwärmte Doudna. Zum Beispiel gebe es Ambitionen, mithilfe der CRISPR-Technologie das Mikrobiom von Rindern genetisch zu verändern, um die Methanproduktion zu senken und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Auch in der Medizin ist das Potenzial laut Doudna „enorm“. Die CRISPR-Technologie kann dabei helfen, Erkrankungen zu behandeln – auch wenn die medizinische Anwendung mehr Zeit und Tests benötigt. Die größte Herausforderung liege laut Doudna darin, die Technologie klinisch sinnvoll einzusetzen und gleichzeitig für alle zugänglich, bezahlbar und nachhaltig zu machen. „Daran arbeiten wir intensiv.“ In der Krebstherapie eröffne CRISPR möglicherweise neue Wege: Immunzellen könnten gezielt programmiert werden, um Tumore effizienter zu bekämpfen – allein oder in Kombination mit anderen Ansätzen wie Impfungen. „In zwei bis fünf Jahren werden wir auf diesem Gebiet vielversprechende Entwicklungen sehen.“ Auch bei Erkrankungen wie Asthma gebe es neue Ansätze: Durch Veränderungen im Mikrobiom eröffnen sich andere therapeutische Perspektiven. Skepsis und Regulierung So groß wie das Potenzial sei jedoch teils auch die Skepsis in der Bevölkerung. Doudna plädiert für Aufklärung statt Polarisierung: „Wir müssen Menschen helfen zu verstehen, was die Technologie kann – und was nicht.“ Und es brauche „ganz klar Regulierungen“: Wissenschaftler:innen, Regierungen und andere Beteiligte müssten sich gemeinsam damit beschäftigen. „Die Entdeckung ist gemacht. Wir können und wollen den Geist nicht zurück in die Flasche stecken. Aber er kommt mit Risiken, mit denen wir umgehen müssen. Und wir sollten diese regulieren.” Etwa müsste die Frage, ob CRISPR an menschlichen Embryonen eingesetzt werden dürfe, laut Doudna „sehr sorgfältig gehandhabt werden“. Derzeit forscht Jennifer Doudna am Howard Hughes Medical Institute und Innovative Genomics Institute der University of California Berkeley & UCSF/Gladstone Institutes. Sorgen bereiten ihr die Kürzungen von Förderungen unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Sie würden die Forschungslandschaft stark belasten. Kürzlich sei auch an ihrem Institut etwa ein Zuschuss für Forschung zur Covid-Pandemie vollends gestrichen worden. Besonders junge Wissenschaftler:innen sind laut Doudna von der Situation betroffen, sie und ihr Team würden versuchen, dagegen zu arbeiten und besonders Jüngere mit Förderungen und Mentoring zu unterstützen. Was die CRISPR-Technologie in Zukunft noch bereit halten wird? „Einiges“, ist sich Doudna sicher. Große Chancen sieht sie nicht zuletzt in der Kombination von Künstlicher Intelligenz (KI) und CRISPR. KI könne Experimente beschleunigen, Hypothesen generieren, neue CRISPR-Proteine entdecken. Aber eines werde sie nie ersetzen: „Menschliche Neugier als Voraussetzung für Grundlagenforschung und neue Entdeckungen“.
Published: May 9, 2025 |